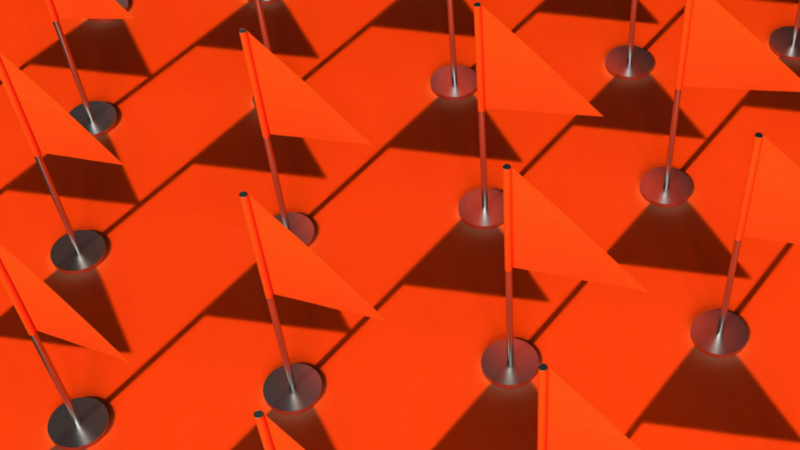Unsere vernetzte Welt verstehen

Die Macht der Plattformen: Die Zukunft der Regulierung nach der Europawahl
Zum ersten Mal seit Inkrafttreten der neuen EU-Vorschriften für digitale Dienste und Märkte fand eine Europawahl statt. Sechs Wochen später ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie funktionieren die neuen EU-Vorschriften gegen plattformbasierte Herausforderungen für die Demokratie in der Praxis? Hat sich der gepriesene Digital Services Act (DSA) bewährt, wenn es darum geht, die Macht der Plattformen zu regulieren? Dieser Artikel zeigt, dass die Herausforderungen bei der Umsetzung des DSA gerade erst begonnen haben.
Die erwartete Welle digitaler Herausforderungen
In den Wochen vor den Europawahlen warnten Nachrichtenagenturen, Forschende, Behörden und Zivilgesellschaft gleichermaßen vor einer Welle der Desinformation. Das Europäische Parlament schrieb in diesem Zusammenhang, dass die Anfang Juni 2024 stattfindenden EU-Wahlen eine “zentrale Institution der europäischen Demokratie” sind und die EU-Organe helfen würden, diese vor Desinformation und Manipulation von Informationen zu schützen. Expert*innen auf der ganzen Welt fürchteten jedoch die sehr reale Möglichkeit, dass Akteur*innen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union versuchen würden, die demokratischen Prozesse der Europawahlen zu untergraben. Ihre größte Sorge galt der Verbreitung falscher Informationen über Wahlverfahren und der Spaltung und Polarisierung innerhalb der EU. Neben Desinformation identifizierte das Democracy Reporting International (DRI) Projekt zum Beispiel Hassrede, ausländische Einmischung und bezahlte politische Werbung (Paid Political Ads, PPAs) als die größten digitalen Bedrohungen für die EU-Wahlen. Wenn es jedoch eine Sache gibt, die wir aus dem Stakeholder-Treffen von DRI lernen können, ist das folgender Punkt: Diese Bedrohungen kommen nicht in einer massiven Welle, sondern eher als separate, kleinere Wellen, die langsam versuchen, die Grundlagen des demokratischen Diskurses zu untergraben. In dem Bemühen, diese weit verstreuten Angriffe zu stoppen, sind Projekte wie Elections24Check mit seiner Faktencheck-Datenbank im Vorfeld der EU-Wahlen 2024 wichtig, um ein Gegengewicht zu Online-Desinformationen zu schaffen.
Keine größeren Zwischenfälle, also eine gute Nachricht?
Da die Wahlen nun hinter uns liegen, kann man mit Sicherheit sagen, dass die erwartete massive Desinformations-Welle nicht über die EU geschwappt ist. Nach Angaben der Task Force der Europäischen Beobachtungsstelle für digitale Medien (EDMO) gab es keine größeren Vorfälle von Desinformationen bei den Wahlen zum EU-Parlament. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Nicht ganz. Nur weil es keine radikalen Berichte über Desinformation gab, bedeutet das nicht, dass die von DRI identifizierten digitalen Bedrohungen nicht zur Realität wurden. Nehmen wir Desinformation als Beispiel. Correctiv und DRI haben festgestellt, dass Chatbots Fehlinformationen über die EU-Wahlen verbreitet haben. Egal, ob Google Gemini, Microsoft Copilot oder ChatGPT verwendet wurde, die Informationen über den Wahlvorgang waren nicht immer korrekt. Dies ist umso alarmierender, da Menschen Chatbots auch wie Suchmaschinen benutzen. Das DRI erinnert uns daran, dass “wenn Wähler*innen [sic] falsch über die Wahlanforderungen informiert werden, können sie von der Stimmabgabe abgehalten werden (weil sie zum Beispiel denken, dass es komplizierter ist als es ist), Fristen verpassen oder andere Fehler machen. Kurz gesagt, diese unbeabsichtigte Fehlinformation kann sich auf das Wahlrecht und die Wahlergebnisse auswirken.” (DRI, S. 2, Übersetzung d. Autor*innen) Aus diesem Grund ist die Regulierung der Macht der Plattformen entscheidend für den Schutz der demokratischen Grundsätze.
Aber es sind nicht nur Chatbots, die im Zusammenhang mit den EU-Wahlen für Desinformation gesorgt haben. Studien zeigen auch eine Vielzahl spezifischer Desinformationsnarrative. Dazu gehören häufig die gezielte Ansprache von Politiker*innen, Anti-EU-Stimmungen oder gefälschte Wahlergebnisse.
Gesetz soll Abhilfe schaffen
Seit Februar 2024 gelten neue EU-Vorschriften, um diesen digitalen Herausforderungen entgegenzuwirken. Sie sollen einen sichereren und gerechteren digitalen Raum schaffen, in dem die Grundrechte der Nutzer*innen geschützt sind. Insbesondere der Digital Services Act (DSA) verpflichtet Plattformen dazu, “angemessene, verhältnismäßige und wirksame Risikominderungsmaßnahmen” zu ergreifen (Art. 35 Abs. 1). Diese zielen beispielsweise auf “alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit” ab (Art. 34 Abs. 1 lit. c).
Der DSA ist mittlerweile seit fünf Monaten in Kraft. Das müsste im Umkehrschluss bedeuten, dass die Plattformen jetzt verpflichtet sind, Maßnahmen zu entwickeln, um den oben genannten digitalen Bedrohungen zu begegnen. Wie eine kürzlich erschienene Studie jedoch zeigt, sind wir möglicherweise noch nicht ganz so weit. Eine vom spanischen Faktencheck-Portal Maldita durchgeführte Studie untersuchte die fünf großen Online-Plattformen (VLOPs) Facebook, Instagram, TikTok, X und YouTube. Diese stellte fest, dass die Plattformen in 45 % der Fälle von Desinformationsinhalten keine sichtbaren Maßnahmen ergriffen haben. Angesichts der Tatsache, dass digitale Plattformen das “wichtigste Schlachtfeld für die öffentliche Meinung” (Übersetzung d. Autor*innen) sind, sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwar leitet die Europäische Kommission weiterhin formelle Verfahren gegen Dienstanbieter ein, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Trotzdem haben wir noch einen langen Weg vor uns, um die Macht der Plattformen zu regulieren und einen sicheren digitalen Raum zu schaffen.
Wie geht es weiter?
Auch wenn es etwas enttäuschend erscheinen mag, dass mit dem Inkrafttreten des DSA im Februar 2024 nicht sofort alle Herausforderungen des digitalen Raums gelöst werden, bedeutet dies nicht, dass sich die Dinge nicht ändern. Zunächst einmal zeigen uns jüngste Analysen, wie Desinformationsagenden im Zusammenhang mit den EU-Wahlen eingesetzt wurden. Diese Untersuchungen liefern bereits wertvolle Erkenntnisse über plattformbasierte Herausforderungen für die Demokratie. Wir gehen davon aus, dass wir aus den Systemrisikobewertungen der einzelnen Dienste (Art. 34), die im Herbst 2024 veröffentlicht werden sollen, noch mehr Erkenntnisse gewinnen können.
Weitere Forschungsarbeiten können auf diesen aufbauen, um besser zu verstehen, “was die dringendsten Quellen von Systemrisiken sind, wo gemeinsame Schwachstellen auftreten und welche Abhilfemaßnahmen negative Auswirkungen wirksam verringern können”, wie das Zentrum für Regulierung in Europa (CERRE) betont. Da der Umgang mit der Macht der Plattformen ein hochkomplexes Unterfangen ist, haben wir unser DSA Forschungsnetzwerk auf den Grundsätzen von Kommunikation und Zusammenarbeit aufgebaut. Das heißt: Wir bringen Interessenvertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen, aus der Wissenschaft und von Regulierungsbehörden zusammen, um frühzeitig Empfehlungen für die ordnungsgemäße Umsetzung des DSA zu geben und mögliche Bereiche für eine notwendige Reform zu identifizieren. Mit diesem sogenannten Circle of Friends bieten wir eine einzigartige Möglichkeit, um verschiedene Perspektiven zu den Herausforderungen und Chancen des DSA zusammenzubringen. Dadurch können wir weitere Forschungsbedarfe identifizieren und legen dabei einen weiteren Schwerpunkt auf das Engagement unterschiedlicher Interessengruppen.
Unser DSA Forschungsnetzwerk ist eine gemeinsame Initiative des Leibniz-Instituts für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, dem DSA Observatory des Institute for Information Law an der Universität Amsterdam und des Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, gefördert von der Stiftung Mercator. Wir haben uns hier bewusst dafür entschieden, einen interdisziplinären Ansatz in das Projektdesign einzubauen: Durch die Zusammenführung juristischer und sozialwissenschaftlicher Perspektiven wollen wir einen umfassenden Blick auf die Umsetzung des DSA ermöglichen. Daher arbeiten wir derzeit an drei Schwerpunkten:
- Operationalisierung risikobasierter Governance-Ansätze,
- Auswirkungen hybrider und risikobasierter Governance auf kollektive Rechte und Werte
- Bewertung von Sorgfaltspflichten und hybrider Governance aus grundrechtlicher Sicht
Erste Ergebnisse aus diesen Schwerpunktbereichen werden wir im Herbst 2024 vorstellen, wenn unser Circle of Friends zum ersten Mal zusammenkommt. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Risikobewertung der einzelnen Dienste veröffentlicht werden. Dadurch werden wir über eine solide Grundlage verfügen, um die Macht der Plattformen im Zusammenhang mit dem DSA besser zu verstehen und zu regulieren.
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autorinnen und Autoren und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Plattform Governance
Freundlich, aber distanziert: Die unbeabsichtigten Folgen KI-generierter E-Mails
KI-generierte E-Mails sparen Mitarbeitenden Zeit und erleichtern den Arbeitsalltag. Aber verlieren wir dadurch unsere Kommunikationsfähigkeiten?
KI am Mikrofon: Die Stimme der Zukunft?
Von synthetischen Stimmen bis hin zu automatisch erstellten Podcast-Folgen – KI am Mikrofon revolutioniert die Produktion digitaler Audioinhalte.
Haben Community Notes eine Parteipräferenz?
Dieser Artikel analysiert, ob Community Notes Desinformation eindämmen oder ob ihre Verteilung und Bewertung politische Tendenzen widerspiegeln.