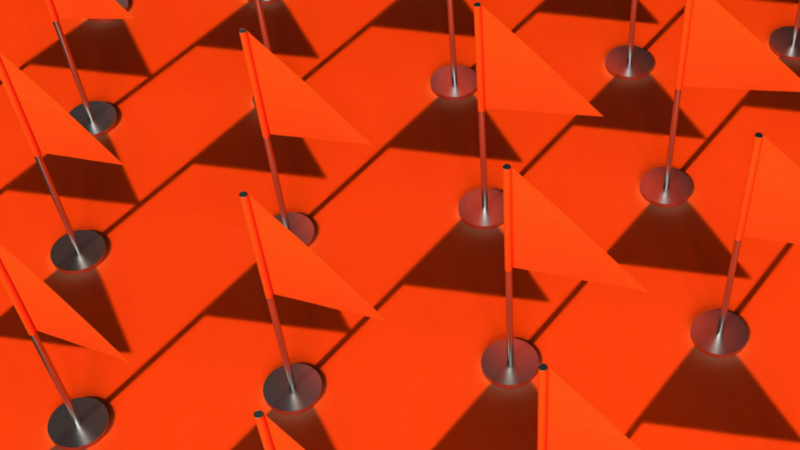Unsere vernetzte Welt verstehen

Europawahl und Digitalpolitik: Positionen der Parteien
Vom 06. bis 09. Juni 2024 finden die zehnten Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Doch wie positionieren sich die deutschen Parteien zur Digitalpolitik? Dieser Blogbeitrag analysiert die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien und untersucht, wo und in welchen Kontexten digitale Themen vorkommen. Von der Forderung der SPD nach einer „Digitalunion“ bis hin zu populistischer Rhetorik um die Ablehnung eines digitalen Euros durch die AfD – die Parteien setzen unterschiedliche digitale Schwerpunkte. Was bedeutet das für Europas digitale Zukunft, insbesondere vor dem Hintergrund eines möglichen Rechtsrucks des Parlaments?
Was haben die Europawahl und Digitalpolitik miteinander zu tun?
Zwischen dem 06. und 09. Juni finden in der Europäischen Union (EU) zum zehnten Mal die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Am 09. Juni können in Deutschland über 64 Millionen Wahlberechtigte darüber entscheiden, welche deutschen Parteien in das Europäische Parlament einziehen werden (Bundeswahlleiterin, 2024). Dieser Beitrag beleuchtet, wie sich die im Bundestag vertretenen Parteien dabei zur Digitalpolitik positionieren.
Digitalpolitik ist ein Querschnittsthema, welches unterschiedliche Bereiche und Technologien umfassen kann, wie zum Beispiel Datenschutz, Sicherheit oder Künstliche Intelligenz (KI). Dieses Themenfeld ist im Vergleich eher neu und nicht vollständig politisiert (Haunss & Hofmann, 2015), kam jedoch in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, immer häufiger in den Wahlprogrammen zu Bundestagswahlen vor (König, 2018; König & Wenzelburger, 2019). Wie sieht es aber auf europäischer Ebene aus? Diese Frage stellt sich besonders, da in den vergangenen Legislaturperioden auch häufig auf europäischer Ebene über Digitalpolitik diskutiert wurde: So wurden kürzlich der EU AI Act und der Digital Services Act diskutiert, und auch die EU-Kommissarin für Digitales Margarete Vestager machte häufig Schlagzeilen mit ihren Forderungen nach Regulierung der großen Digitalunternehmen.
Zwischen „Digitalunion“ und Datenschutz-Grundverordnung: Überblick über die Parteien
Um mehr über die Politisierung von Digitalpolitik bei den anstehenden Europawahlen zu erfahren, wirft dieser Blogbeitrag einen Blick in die Wahlprogramme der im deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Dabei wurden die Kapitel und Unterkapitel zur Digitalpolitik berücksichtigt, sofern diese vorhanden waren. Zusätzlich wurde eine Stichwortsuche durchgeführt, um festzustellen, wo digitalpolitische Querschnittsthemen in anderen Teilen der Programme auftauchen. Diese Analyse gibt keine Wahlempfehlung ab, sondern hebt die besonderen Schwerpunkte der einzelnen Parteien hervor.
SPD: Betonung der „Digitalunion“
Die SPD widmet der Digitalpolitik, neben Nennungen des Themenfeldes an anderen Stellen, ein eigenes Kapitel mit dem Titel „Digitalisierung für den Menschen“, in welchem die Verwirklichung der „Digitalunion“ (SPD, 2024, S. 15) gefordert wird. Dieser Begriff ist spannend, da er die Bedeutung der Digitalpolitik für die EU ähnlich unterstreicht wie andere Ausdrücke, die die Besonderheit der EU hervorheben sollen, wie z.B. „Wirtschaftsunion“ oder „Werteunion“. Auch KI wird europäisch angestrichen, da die SPD fordert, dass die Entwicklung und der Einsatz von KI nicht näher definierten „europäischen Werten“ folgen müsse (SPD, 2024, S. 17). Passend zu den Themenschwerpunkten der SPD tauchen die Themen Digitalisierung und KI auch im Kontext der Arbeitswelt und dem Schutz von Beschäftigten auf. Die Regulierung von digitalen Plattformunternehmen solle zuerst evaluiert und eventuell verbessert werden, ebenso solle die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) „weiterentwickelt“ werden, z.B. durch einen Abbau von Bürokratie (SPD, 2024, S.15).
Union: Digitalpolitik als Thema der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik
Die Union behandelt Digitalpolitik in einem Unterkapitel, gemeinsam mit den Themen Forschung und Innovation. Allerdings ist Digitalpolitik auch an anderen Stellen des Wahlprogramms ein Thema. Besonders häufig wird Digitalpolitik gemeinsam mit Themen aus den Gebieten Wirtschaft sowie Sicherheit und Kriminalität genannt. Hervorzuheben ist auch, dass die Union das Thema Digitalpolitik vor dem Hintergrund von Regulierung und Innovation verhandelt: Im Technologieverständnis der Union stehen sich Regulierung und Innovation als Gegenpole gegenüber, dies bezieht sich z.B. auf die Themengebiete digitaler Binnenmarkt, Datenschutz sowie KI. So betont die Union, dass „neue Vorschriften […] Innovation in KI nicht abwürgen“ dürfen (CDU, 2024, S. 11).
Bündnis 90/ Die Grünen: Menschenrechte und Klimaschutz im Digitalen
Die Grünen legen ein über 100 Seiten langes Wahlprogramm mit gleich zwei Kapiteln zur Digitalpolitik vor. Besonders betonen die Grünen die Themenbereiche Menschenrechte, Desinformation sowie Diskriminierung im Internet, wobei sie die EU als ein Vorbild in der „digitalen Welt“ hervorheben (Grüne, 2024, S.111-112). Ebenfalls passend zum Themenprofil der Grünen werden die negativen Folgen der Digitalisierung für Nachhaltigkeit und Klima unterstrichen und eine konsequente Umsetzung des Digital Market Acts (DMA), des Digital Service Act (DSA) und des Verbraucherschutzes gefordert. Ähnlich wie die SPD assoziieren die Grünen KI ebenfalls mit der Notwendigkeit einer „europäischen“ Ausgestaltung, wobei die Grünen hier näher definieren und auf Menschenrechte und Technologiefolgenabschätzung verweisen (Grüne, 2024, S. 24). Spannend ist, dass das Thema Cyberkriminalität explizit mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in Verbindung gebracht wird (Grüne, 2024, S. 113).
AfD: Gegen die EU als Akteurin im Themenfeld Digitalpolitik
Die AfD fokussiert sich kaum auf Digitalpolitik und ein Großteil ihrer digitalpolitischen Vorschläge beziehen sich auf die Ablehnung eines digitalen Euros. Dabei suggeriert die Partei, dieser würde zu einer Abschaffung des Bargelds führen, was im nächsten Schritt zur Einführung eines Social Credit Systems wie in China führen könnte (AfD, 2024, S. 21). Die AfD folgt auch einer populistischen Rhetorik (Akkerman et al., 2014; Meijers & Zaslove, 2020) in dem sie Brüssel diskursiv als Organ darstellt, welches gegen den Bürger*innenwillen und Staaten agiert, beispielsweise im Bereich der digitalen Bildung oder Währung (AfD, 2024, S. 49, 51). Ebenfalls wird die EU als „Datenkrake“ bezeichnet, während gleichzeitig die Abschaffung der DSGVO gefordert wird (AfD, 2024, S. 42). Weiterhin postuliert die AfD, dass die Digitalisierungsverordnungen der EU das Ziel der Überwachung und Zensur der Bürger*innen zum Ziel hätten (AfD, 2024, S. 42). Dies könnte als ein weiteres Indiz der Politisierung von Digitalpolitik gesehen werden, da diese populistisch aufgeladen wird.
FDP: Der „digitale Chancenkontinent“ zwischen Freihandel und Privatsphäre
Die Vorschläge der FDP zur Digitalpolitik adressieren sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich konnotierte Themenfelder: So erwähnt die FDP Digitalpolitik im Kontext von Wirtschaftsthemen gleich zu Beginn (FDP, 2024, S. 2), beispielsweise im Kontext von Freihandelsabkommen oder digitaler Währung, aber führt auch gesellschaftliche Themen zu Privatsphäre oder Uploadfilter auf (FDP, 2024, S. 11-12). Ob die Betonung der gesellschaftlichen und ökonomischen Dimension der Digitalisierung ein Spannungsfeld darstellt, wird nicht erwähnt. Häufig taucht ebenfalls die Idee einer Entbürokratisierung auf, welche nicht näher spezifiziert wird. Die FDP fordert außerdem Europa solle ein „digitaler Chancenkontinent“ sowie Hotspot für „unbürokratische“ KI werden, wobei die USA im Hinblick auf KI-Trainingsdaten als Vorbild genannt werden (FDP, 2024, S. 17-18).
Die Linke: Digitalisierung im Kontext von sozialer Sicherheit und Plattformmacht
Digitalpolitik kommt bei den Linken recht häufig vor, wie im Vorwort des Wahlprogramms, in speziellen Kapiteln, sowie direkt vor dem Schlusswort. Dabei legen die Linken einen Fokus auf Themen wie Beschäftigtenschutz: Der Datenschutz solle sowohl für Beschäftigte traditioneller Unternehmen als auch für prekär Beschäftigte von digitalen Plattformunternehmen gestärkt werden. Weiterhin soll „das Internet von den Konzernen befrei[t]“ werden, und zur Lösung „gesellschaftlicher Probleme beitr[agen]“ (Die Linke, 2024, S. 46). Thematisch werden auch Nachhaltigkeit sowie Datenschutz und digitale Teilhabe angesprochen.
Bündnis Sahra Wagenknecht: Kaum digitalpolitische Vorschläge und EU-Kritik
Bei dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) taucht Digitalpolitik nur vereinzelt auf. Europa wird hier als „digitale Kolonie“ der USA dargestellt, und die wenigen digitalpolitischen Stellen fokussieren sich auf die Dominanz US-amerikanischer Großkonzerne oder Nachhaltigkeit (BSW, 2024, S. 4). Hervorzuheben ist auch,wie das BSW sich populistischer Rhetorik (Akkerman et al., 2014; Meijers & Zaslove, 2020) bedient, um den Digital Services Act zu kritisieren: So wird der EU unterstellt, dieser wurde insgeheim zur Durchsetzung von „Cancel Culture“ und der Eindämmung von „regierungskritische[n] Positionen bei sensiblen Themen“ beschlossen (BSW, 2024, S. 20).
Zukunft der Digitalpolitik?
Digitalpolitik kommt in den Programmen aller analysierten Parteien vor. Jedoch unterscheiden sich die Parteien in Bezug auf den Stellenwert, den sie diesem Themenfeld widmen. Auch in Bezug auf die thematische Schwerpunktsetzung – wie auf beispielsweise eine eher gesellschaftliche oder wirtschaftliche Konnotation von Digitalpolitik – gibt es Unterschiede. Dabei fügt sich die thematische Schwerpunktsetzung in die Parteiprofile ein. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass Digitalpolitik von einigen Parteien mit populistischer Rhetorik angesprochen wird. Da rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien einen großen Sitzanteil im neuen Europäischen Parlament haben könnten, stellt sich auch die Frage, welche Auswirkungen dies auf digitalpolitische Policies wie die DSA oder DSGVO haben könnte. Die verstärkte Beschäftigung mit digitalpolitischen Themen und die Prägung von Begriffen wie „Digitalunion“ wirft die Frage auf, ob sich das Themenfeld der Digitalpolitik in Zukunft als ein europäisches Thema durchsetzen könnte.
Dieser Beitrag spiegelt die Meinung der Autorinnen und Autoren und weder notwendigerweise noch ausschließlich die Meinung des Institutes wider. Für mehr Informationen zu den Inhalten dieser Beiträge und den assoziierten Forschungsprojekten kontaktieren Sie bitte info@hiig.de

Jetzt anmelden und die neuesten Blogartikel einmal im Monat per Newsletter erhalten.
Plattform Governance
Freundlich, aber distanziert: Die unbeabsichtigten Folgen KI-generierter E-Mails
KI-generierte E-Mails sparen Mitarbeitenden Zeit und erleichtern den Arbeitsalltag. Aber verlieren wir dadurch unsere Kommunikationsfähigkeiten?
KI am Mikrofon: Die Stimme der Zukunft?
Von synthetischen Stimmen bis hin zu automatisch erstellten Podcast-Folgen – KI am Mikrofon revolutioniert die Produktion digitaler Audioinhalte.
Haben Community Notes eine Parteipräferenz?
Dieser Artikel analysiert, ob Community Notes Desinformation eindämmen oder ob ihre Verteilung und Bewertung politische Tendenzen widerspiegeln.