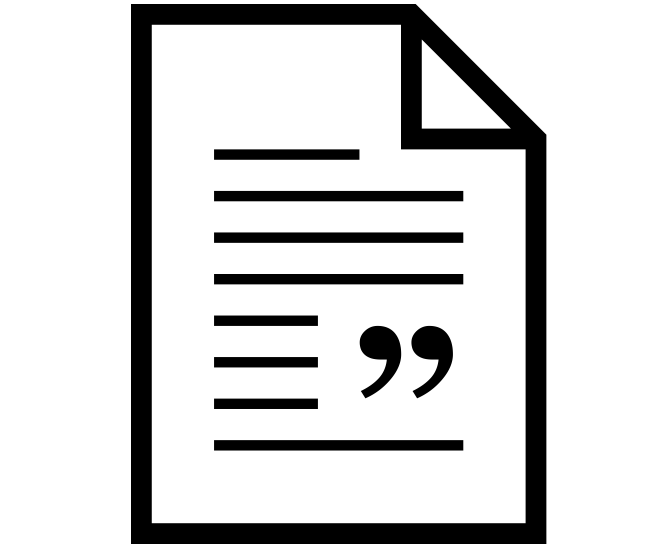Überwachung steht – so die übliche Lesart – in einem antagonistischen, gar zerstörerischen Verhältnis zur Autonomie. Im vorliegenden Beitrag werden etablierte Grundannahmen wie diese entlang dreier Thesen kritisch diskutiert: Erstens ist Überwachung nicht in einem solchen destruktiven Verhältnis zur Idee der Autonomie zu denken, denn beide stehen in einem wechselseitig konstitutiven Zusammenhang. Dieser beschreibt zweitens in einem idealtypischen, modernen Verständnis ein Gleichgewicht, das sich durch medientechnologische Praktiken verändert hat. Drittens rührt die Bewertung von Überwachungspraktiken im Hinblick auf individuelle Handlungsfreiheit, Autonomie oder Privatheit an normativen Vorstellungen des Diskurses der Moderne, deren Prämissen in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend verwässert wurden. „Hochinvasive“ Überwachung wird im Beitrag dadurch charakterisiert, dass sie Emotionen, Persönlichkeitsmerkmale und psychologische Dispositionen zum Objekt hat. Ein solches, in weiten Teilen fiktionales Überwachungswissen über Gruppen und Einzelpersonen birgt das Risiko einer totalen Überwachungsgesellschaft. Die technische Entwicklung hochinvasiver Überwachung entzieht sich einer normativen Bewertung in tradierten Konzepten wie „Autonomie“, „Privatheit“ oder „Selbst“. Ein starres Festhalten an diesen kaschiert die wahrhaft destruktive Kraft der neuen Überwachungspraktiken.